Fels in der Brandung
Ad primae partis quaestionem IX
De immutabilitate divina. – Über die göttliche Unveränderlichkeit.
Quaestio 9 besteht lediglich aus zwei, systematisch verbundenen, Kern-Artikeln und beschränkt sich auf eine parallel gebaute Gegenüberstellung, die uns bereits aus mehreren Vorgängerfragen bekannt ist. Ist Gott – wirklich, vollständig, ausnahmslos – ein P? Gefolgt von der symmetrischen Frage: »Ist Gott das einzige P?« , bzw. »Sind dann alle von Gott unterschiedenen Wesen nicht P?«, bzw. »Gibt es in der Welt ein, von Gott verschiedenes, geschaffenes P?«.
Wie gesehen, konnten wir für »P« bereits mehrere Prädikatoren einsetzen, die Gott und seine Welt radikal voneinander unterscheiden:
- »… ist Anfang einer Begründungskette« (ST I, q. 2),
- »… ist einfach« (ST I, q. 3),
- »… ist vollkommen« (ST I, q. 4),
- »… ist höchstes Gut« (ST I, q. 5 et 6),
- »… ist unendlich« (ST I, q. 7) und heute nun
- »… ist unveränderlich«
Es kann nicht wirklich überraschen, dass, wie in allen Präzedenzfällen, auch das heutige Gottesprädikat, Seine Unveränderlichkeit, nicht etwa einen überraschenden Schulterschluss, sondern, wie bereits vertraut, eine unmissverständliche, diesmal sogar besonders krasse Entgegensetzung von Gott und Welt, Schöpfer und Schöpfung vorführt.
Thomas präsentiert drei Gründe für die »Immutabilitas Dei«, und greift dabei auf folgende Grundunterscheidungen zurück, die uns allesamt bereits mehrfach begegnet sind:
(1) Akt, Potenz und der sogenannte actus purus
(2) Teil, Ganzes und die Einfachheit Gottes
(3) Perfektion und Unendlichkeit Gottes
In der Neunten nix Neues, so möchte es scheinen, doch in gewisser Weise liegt sie uns quer und kann unser Befremden, womöglich gar unseren Widerwillen erregen. Das hat sie mir dann doch noch recht interessant gemacht.
(1) Alles, nur bitte nicht »Henne oder Ei«
In einer ersten Begründung greift Thomas das exemplarische Actus-Purus-Argument aus dem dritten Gottesbeweis auf (ST I, q. 2, a. 3 tertia via). Wir gehen von der Annahme eines »Ersten Seins« aus, und dieses bezeichnen wir als Gott (»esse aliquod primum ens, quod Deum dicimus« – ST I, q. 9, a. 1 co.). Anders als jedes zweite, dritte ff. Sein können wir dieses »Erste Sein« nicht als Ergebnis einer Verwirklichung verstehen. Alles was ist, genauer, alles was außer diesem Ersten Sein existiert, wurde zu etwas Wirklichem, und ist damit Akt eines bestimmten Seins. Die Potenzialität des »so oder anders sein könnens« wurde zur Aktualität des »so und nicht anders Seins«, und damit sozusagen aus der Vielfalt der Möglichkeiten auf die eine Wirklichkeit festgelegt.
Wollen wir den Begründungsregress vermeiden – und das sollten wir, um der Geschwätzvermeidung willen, unbedingt wollen – ist uns die Annahme eines solchen gewissen »Ersten Etwas« nicht einfach freigestellt. Sie ist vor allem alles andere als beliebig. Vielmehr ist eine solche Annahme zwingend notwendig, wollen wir den nervenden Loops des Gaga-Fundamentalismus entgehen – »Und was war dann davor?« oder »Hat hier möglicherweise jemand die erste Möglichkeitsoption eröffnet, ohne zuvor selbst den ersten Wirklichkeits-Abschluss getätigt zu haben?«
Hier steht natürlich wieder mal die allfällig-unvermeidliche Henne-oder-Ei-Frage bereit. Doch nur als entlarvendes Beispiel für eine saudumme Frage, lässt sie den Fragesteller nicht selbst alt aussehen. Die auftrumpfende Geste des vermeintlich cleveren Querdenkers – »pah, Alter, Henne-Ei-Ei-Henne, haste kapiert, jetzt sagste nix mehr« gereicht dem ach so kritischen Nachfrager zur peinlichen Einsicht, dass es eben nicht jedem nassforschen Spacken zur Skepsis reicht. Die braucht nämlich stets besonders gute Gründe um uns irritieren zu können. Und die wiederum sind ohne Regressvermeidung nicht zu haben.
Keine Skepsis ohne die Bedingung der Möglichkeit begründeten Zweifel. – Et hoc dicimus Deum!
Sollen wir uns also nicht in einer endlosen Potenzsaktualisierungsschlange die Füße in den Bauch stehen, müssen wir einen »actus purus«, einen reinen Akt annehmen, der nicht aus der Aktuierung einer vorgängig sich bereithaltenden potentia (einer ominösen »prima potentia«,wenn man so will) hervorgegangen ist, und der keinerlei Beimengung von Potenzialität an sich hat (»huiusmodi primum ens oportet esse purum actum absque permixtione alicuius potentiae« ST I, q. 9, a. 1 co.). Und dieses ungewordene Etwas nennen wir nun einmal Gott.
(2) Peu à peu
Ein zweites Argument hebt auf die Kontinuierlichkeit von Veränderungen ab (auch wenn Thomas hier »motus, movetur, moveri« – »Bewegung, bewegt werden« verwendet, ist, anders als im heutigen Sprachgebrauch, nicht nur räumliche Bewegung von Ort zu Ort, sondern jede Form von Veränderung, Zustandsänderung, Wandel, Wachstum, Werden und Vergehen gemeint.) Veränderungen mögen, etwa im Fall einer Explosion, rasch ablaufen, vollziehen sich jedoch nicht sprunghaft, so als ob ein Gegenstand in einem bestimmten Zustand, mit bestimmten Eigenschaften instantan gegen einen anderen in anderem Zustand mit anderen Eigenschaften ausgetauscht worden wäre. Vielmehr vollziehen sich Veränderungen an einem sich verändernden Gegenstand. Kontinuierlichliche Veränderung setzt die Kontinuität einer zugrundeliegenden Substanz voraus. Das beschreibt Thomas nun so, dass an dieser Substanz Veränderungen »teilweise« und peu à peu, sozusagen Stück für Stück, eins nach dem anderen, vor sich gehen.
Da Gott jedoch, wie in ST I, q. 3, a. 7 verhandelt, ganz und gar einfach ist, finden sich an ihm weder Teile, noch kann er insbesondere als eine Zusammensetzung derselben verstanden werden. Somit kann an Ihm auch keinerlei Veränderung stattfinden.
Ein drittes Argument bringt unbeabsichtigt einen Zungenschlag ins Spiel, der unseren zeitgenössischen common sense ein wenig irritieren könnte.
(3) Deus Perfectissimus
Never change a winning team, heißt es, und wir alle kennen die Gefahr der »Verschlimmbesserung«, mit der gnadenlose Perfektionisten alles noch so richtig verkacken können. Ein Pinselstrich zuviel, ein überflüssiges Wort, eine aufgesetzte Geste, eine überdehnte Verzierung, ein überladenes Riff und der Zauber der Vollkommenheit wäre dahin. Dieser Intuition folgen wir gerne, doch dann nimmt das Argument eine schroffe Wendung.
Die vollständige und restlose Verwirklichung schlechthin aller Seinsmöglichkeiten, und damit zugleich die Realisierung des Bestmöglichen, lässt nichts mehr zu tun übrig. Der Spielraum an Möglichkeiten ist für Gott voll und ganz ausgeschöpft. Eine Veränderung, insbesondere eine Verbesserung oder Vervollkommnung, ist dem »Deus Perfectissimus« unmöglich!
»Gott aber, da er unendlich ist, und in sich die ganze Fülle der Vollkommenheit allen Seins umfasst, kann weder irgendetwas hinzuerwerben, noch kann er sich auf etwas ausdehnen, das er nicht bereits zuvor umfasste. Daher hat Gott in keiner Weise irgendetwas mit Veränderung zu tut.«
»Deus autem, cum sit infinitus, comprehendens in se omnem plenitudinem perfectionis totius esse, non potest aliquid acquirere, nec extendere se in aliquid ad quod prius non pertingebat. Unde nullo modo sibi competit motus.« (ST I, q. 9, a. 1 co.)
Nicht der Weg ist das Ziel
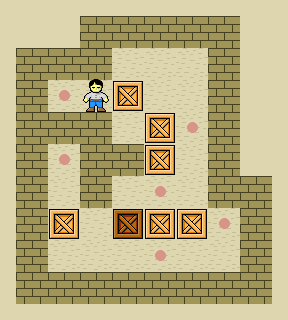 Der pejorative Sound ist allemal unserem modernen, vielleicht bereits dem neuzeitlichen, Sprachgefühl unüberhörbar. Man könnte an ein leicht panisches Sokoban-Männchen denken, das sich jeden Spielraum verbaut hat, und nun, nach dem Verlust aller noch offenen Möglichkeiten, einen letzten verzweifelten Zug tut, um sich damit unausweichlich zur vollständigen Bewegungslosigkeit einzumauern – Armer Tropf, pauper, pauper, nullo modo sibi competit motus.
Der pejorative Sound ist allemal unserem modernen, vielleicht bereits dem neuzeitlichen, Sprachgefühl unüberhörbar. Man könnte an ein leicht panisches Sokoban-Männchen denken, das sich jeden Spielraum verbaut hat, und nun, nach dem Verlust aller noch offenen Möglichkeiten, einen letzten verzweifelten Zug tut, um sich damit unausweichlich zur vollständigen Bewegungslosigkeit einzumauern – Armer Tropf, pauper, pauper, nullo modo sibi competit motus.
Muten die ersten beiden Argumente eher technisch und wertneutral an, ist man beim dritten, dem, aus Thomas Perspektive, weitaus stärksten Argument geneigt zu fragen, was überhaupt an der Unveränderlichkeit so toll sein soll. Gilt sie nicht als gruseliger Vorbote des Alters, der Erschöpfung und nachlassender Vitalität? – Starrsinn, Stumpfsinn, alter Trott? – Sind nicht permanente Bewegung, geistige Flexibilität, lebenslanges Lernen angesagt? Mit fünfzig nochmal was gaaanz anderes machen, uneingeschränkt mobil bleiben, jeden neuen Tag zum Abenteuer werden lassen!Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem, das Wissen, die Hoffnung, die Einbildung, man habe noch Chancen und Möglichkeiten, dieses Jahr mal nicht an den Gardasee … was wäre so schlimm daran?
Erst wenn es zu bunt getrieben wird, wenn Wechsel und Wandel auf die Spitze getrieben werden, regt sich ein Bedenken, wie es denn um die Solidität der zugrundeliegenden Substanz bestellt sein mag, an der sich Alles so »beständig verändert«.
In unbedingtem Willen zur Hymne auf des Meisters neues Cover-Album mit Frank Sinatra Standards (sic!) gerät unendliche Wandlungsfähigkeit zu ewiger Beständigkeit – hier scheint sich die Schlange in den Schwanz zu beißen:
»Dylan, der Bauchredner der Tradition: Alles an seiner Musik ist Variation auf Bekanntes, doch nichts bleibt gleich, weil die alten Geschichten neu erzählt werden wollen. Es herrscht Dauerséance in Dylans Geisterrepublik, wenn er gerade nicht zum Blues zurückkehrt, erkundet er verborgenere Winkel des Americana-Kosmos. In den letzten Jahren hat er sich sogar einen gewissen Swing zugelegt, doch welcher Dylan der wahre ist, bleibt wie immer offen. Die Pointe seines Schaffens liegt in der Einsicht, dass „Dylan“ selbst nur ein Medium ist: Er spricht in den Zungen einer verschwindenden Welt.« (ZEIT Online, 29.01.2015)
Die gute Presse, die Wandlungsfähigkeit, Innovationswille und geistige Offenheit genießen, wie auch die unbedingte Wertschätzung von Handlungsspielräumen und der Vielfalt von Möglichkeiten würde vermutlich bei Thomas kein vergleichbares Befremden auslösen, wie umgekehrt sein Lob der Immutabilitas bei uns. Wohl aber wäre er irritiert über die Selbstzweckhaftigkeit unserer Veränderungsbereitschaft und die korrespondierende Lebensmaxime »Der Weg ist das Ziel«, die aus der Not der Orientierungslosigkeit eine zweifelhafte Tugend macht.
Veränderung – Selbstveränderung und Weltveränderung – Anpassung der Welt an unsere Bedürfnisse, oder umgekehrt, Adaption an nicht selten widrige Gegebenheiten, gilt sinnvollerweise der Bewältigung eines Mangels, der Selbst- und Arterhaltung, der Überwindung von Widerständen auf dem Weg zu einem Ziel. Man tut und macht, man biegt und beugt sich doch nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil man es muss, weil man sozusagen von den Umständen dazu gezwungen wurde. Sachzwänge sind doch immer an allem Schuld, also wohl auch an unserer widerwilligen Bereitschaft zur Veränderung. Man verändert sich und die Welt (in der uns zu Gebote stehenden Handlungsreichweite) um eines Zieles willen. Hat man dieses Ziel erreicht, kann und sollte man auch endlich mal zur Ruhe kommen dürfen, sich einer gewissen Vollkommenheit (besser geht’s, besser kann ich’s nicht) erfreuen und bitteschön keinen Finger mehr krumm machen.
Nicht, dass Thomas, als bravem Aristoteliker, Tätigkeiten fremd gewesen wären, die gerade deshalb hoch und edel einzuschätzen sind, weil sie um ihrer selbst willen getan werden. Auch dürfte er, wie wir hoffentlich auch noch, über problematische Menschen den Kopf geschüttelt haben, die zwanghaft das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden müssen, und so den Spaziergang »verpassen«, weil sie auf dem Weg gleich noch ein paar Besorgungen erledigen wollen.
Doch so klar es Thomas war, dass das Leben als Ganzes ein unwandelbares, feststehendes und damit orientierendes Ziel hat, so merkwürdig und schräg müssten ihm schrullige Lebenskunden angemutet haben, die einem empfehlen, »sich beständig neu zu erfinden«, die einem zu frischem »Selbstentwurf« raten, nachdem man endlich ausgetretene Pfade verlassen habe. Wir haben doch, so würde er mit den Schultern zucken, bereits als Mensch qua Mensch eine ausgerichtete Natur, eine Festlegung, eine Bestimmung, die unseren »Spielraum des Scheiterns« Gott sei Dank beschränkt, und die zu unterlaufen oder zu überformen, im harmlosen Fall als individualistischer Schabernack durchgehen mag, im Worst Case jedoch zu einem verpeilten und verfehlten Leben im Ganzen führen kann.
Mit der Zielvorgabe eines finis ultimus, die dem ganzen Leben in seinem tätigen, denkenden und fühlenden Gesamtzusammenhang, Richtung und Bestimmung gibt, geht Thomas allerdings weit über Aristoteles hinaus. Das gute, das gelingende und glückende Leben, die Eudaimonia, entfaltetet sich für Aristoteles, den Heiden, in der unbehinderten, zwanglosen Betätigung und »Ausübung« unserer natürlichen Vermögen – soweit schicksalhaft möglich – sollte man einschränken. Also möglichst vollständig, möglichst ungezwungen, möglichst störungs- und unterbrechungsfrei. Doch auch das vortrefflichste, an Vorzügen und Vorteilen reichste Leben lässt, wenn es endet, »offene Enden« zurück. Das lebenslange Glückskind, der beneidenswerte makarios stirbt unbefriedigt – beunruhigt weil unberuhigt – und damit in einem ungelösten Zustand der Veränderlichkeit.
Für Thomas, den Christen, bleibt dies freilich nicht das letzte Wort. Das Glück der antiken Philosophen erscheint Thomas ebenso eingetrübt, wie die Sichtweise einer »unerleuchteten« Ethik, die, mangels Offenbarung, das letzte Ziel des menschlichen Weges nicht kennen konnte. Das relative »Gutgehen in diesem Leben (in hac vita)« unter den Rahmenbedingungen von Immanenz und Endlichkeit nennt Thomas »beatitudo viae«, bzw. »beatitudo in via« – das »Glück des (diesseitigen) Weges«, ein Gelingen während wir unterwegs sind. Sich damit zufrieden zu geben, wäre allerdings schlimmer als falsche Bescheidenheit, nachdem uns die Offenbarung ein Letztes Ziel in hoffnungsvolle Aussicht gestellt hatte. Die »beatitudo patriae«, bzw. »beatitudo in patria« stellt die strahlendsten Erfolge der Lebenskunst in den Schatten. Eine solche »Glückseligkeit daheim beim Vater«, das »Glück in der himmlischen Heimat« ist jedoch kein phantastischer Aufsatz, keine spekulative Aufstockung auf irdische Glücksvorstellungen, vielmehr gibt es einen durchaus diesseitigen Indikator, der uns die Annahme eines solchen Endziels nahelegt. Das desiderium naturale, unser natürliches Verlangen, bleibt es ungestillt, macht sich drängend und drückend bemerkbar, und scheint uns zu oftmals blindem Aktionismus bis hin zu verzweifeltem »Mutabilismus«, einem gehetzten Drang zu desorientierter Veränderung um der bloßen Änderung willen, zu zwingen. Die gnadenhafte Erfüllung dieses Verlangens in vollkommener Restlosigkeit behilft jedoch jeder noch verbliebenen Rastlosigkeit.
Das Erreichen dieses finis ultimus liegt in der Schau eines unveränderlichen Gottes, der unmittelbaren Anschauung des sumum bonum, des höchsten Gutes. Diese visio beatifica lässt uns an einer Unveränderlichkeit teilnehmen, die aus vollkommener Befriedigung des desiderium naturale erwächst. Ein Weg ohne Ziel, oder vielleicht gefährlicher, ein Weg mit immanentem Ziel, muss diesen Ruhezustand verfehlen. Das Leben droht zur Freizeit zu geraten, die nach einem Zeitvertreib verlangt, den es möglichst abwechslungsreich zu gestalten gilt.
© 2020 Christoph D. Hoffmann
Bildnachweise
Crivelli: Wikimedia | Sokoban: Wikimedia


